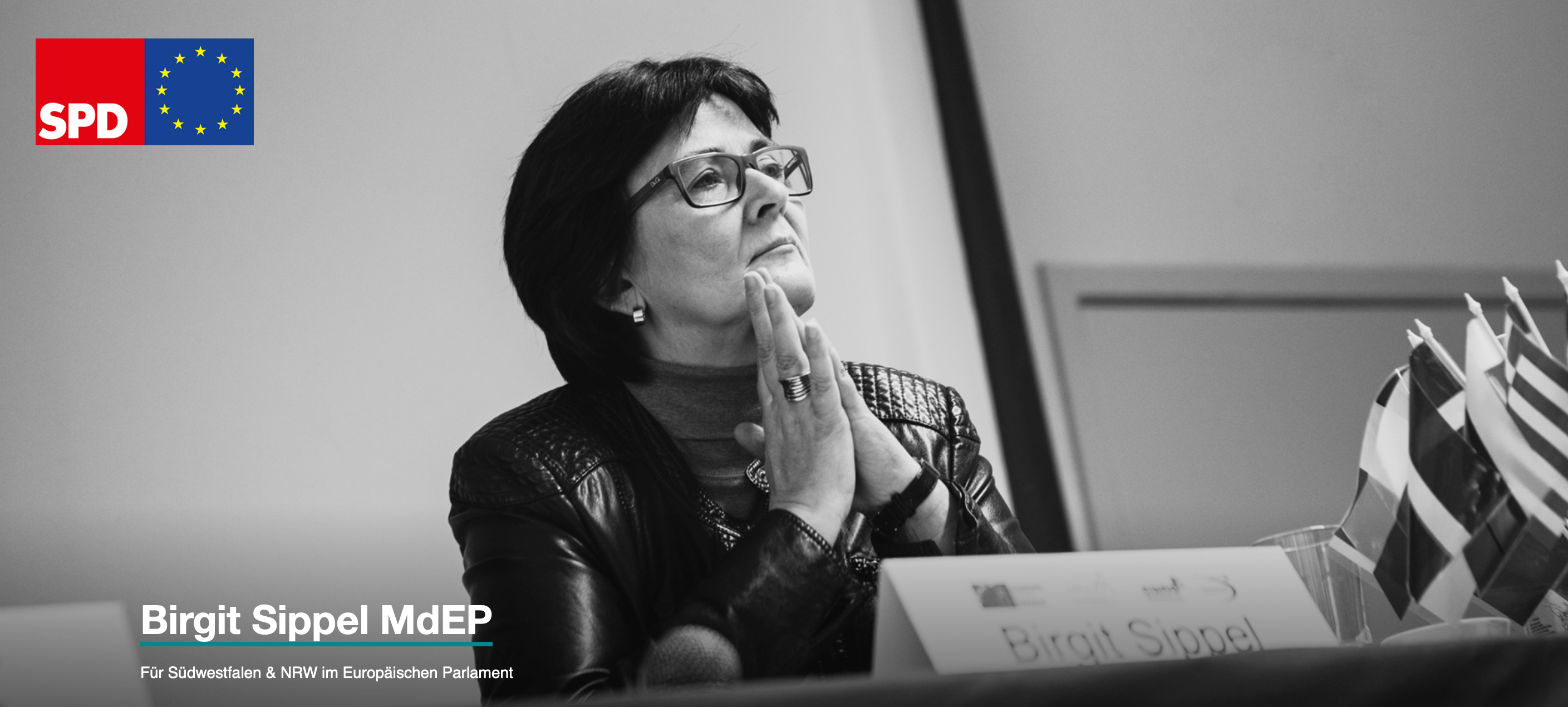Achim Post setzt sich für interkulturellen Schüler:innenaustausch ein
Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) wurde vor 40 Jahren vom Deutschen Bundestag und dem US Congress ins Leben gerufen: Ein Vollstipendium, das den deutschen und US-amerikanischen Jugendlichen ermöglicht, für ein Schuljahr das jeweils andere Land kennenzulernen und als Junior-Botschafter:innen die Freundschaft der beiden Länder sowie den Kulturaustausch zu stärken.
Für die Austauschzeit bekommen alle Teilnehmenden einen Paten oder eine Patin aus dem Bundestag zur Seite gestellt. Auch in diesem Jahr übernimmt der heimische Bundestagsabgeordnete Achim Post eine Patenschaft für eine oder einen ausgewählten Teilnehmenden. Achim Post: „Ich freue mich, junge Menschen dabei unterstützen zu können, durch das Stipendium neue kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Dieses unvergessliche Erlebnis fördert den Zugang der Teilnehmenden zu anderen Lebensweisen und stärkt gegenseitiges Verständnis und Toleranz.“
Achim Post möchte zudem die Familien im Mühlenkreis dazu ermutigen, selbst eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten aus den USA während des Austauschjahres bei sich aufzunehmen, denn die Austauscherfahrung bedeutet für beide Seiten eine wertvolle Erfahrung. Anders als sonst gibt es aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten in diesem Jahr einen Kostenzuschuss in Höhe von 80 Euro im Monat für die Familien, die Stipendiantinnen und Stipendiaten im Rahmen des PPP aufnehmen.
Gastfamilie kann jede:r werden – ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Neugier, Toleranz und die Bereitschaft, sich auf ein neues „Familienmitglied auf Zeit“ einzulassen. Die 50 US-Amerikaner:innen reisen am 2. September 2023 an und bleiben für zehn Monate in Deutschland. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden, die sich um die Organisation und Durchführung des Austauschs kümmert. Ansprechpartner ist Matthias Lichan (Tel.: 0228 95722-21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de). Weitere Informationen rund um das Thema Gastfamilie gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden.
Bald beginnt auch die Bewerbungsphase für deutsche Schüler:innen, die mit dem Stipendium ein Auslandsjahr in den USA verbringen möchten. Bewerbungen für das 41. PPP im Schuljahr 2024/25 sind voraussichtlich ab dem 2. Mai d. J. möglich. Weitere Informationen sind unter www.bundestag.de/ppp zu finden.
Über Experiment
Das Ziel von Deutschlands ältester, gemeinnütziger Austauschorganisation, Experiment, ist seit 90 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experiment in International Living” (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmende mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u. a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag. Mehr Informationen zum Verein gibt es auf www.experiment-ev.de.