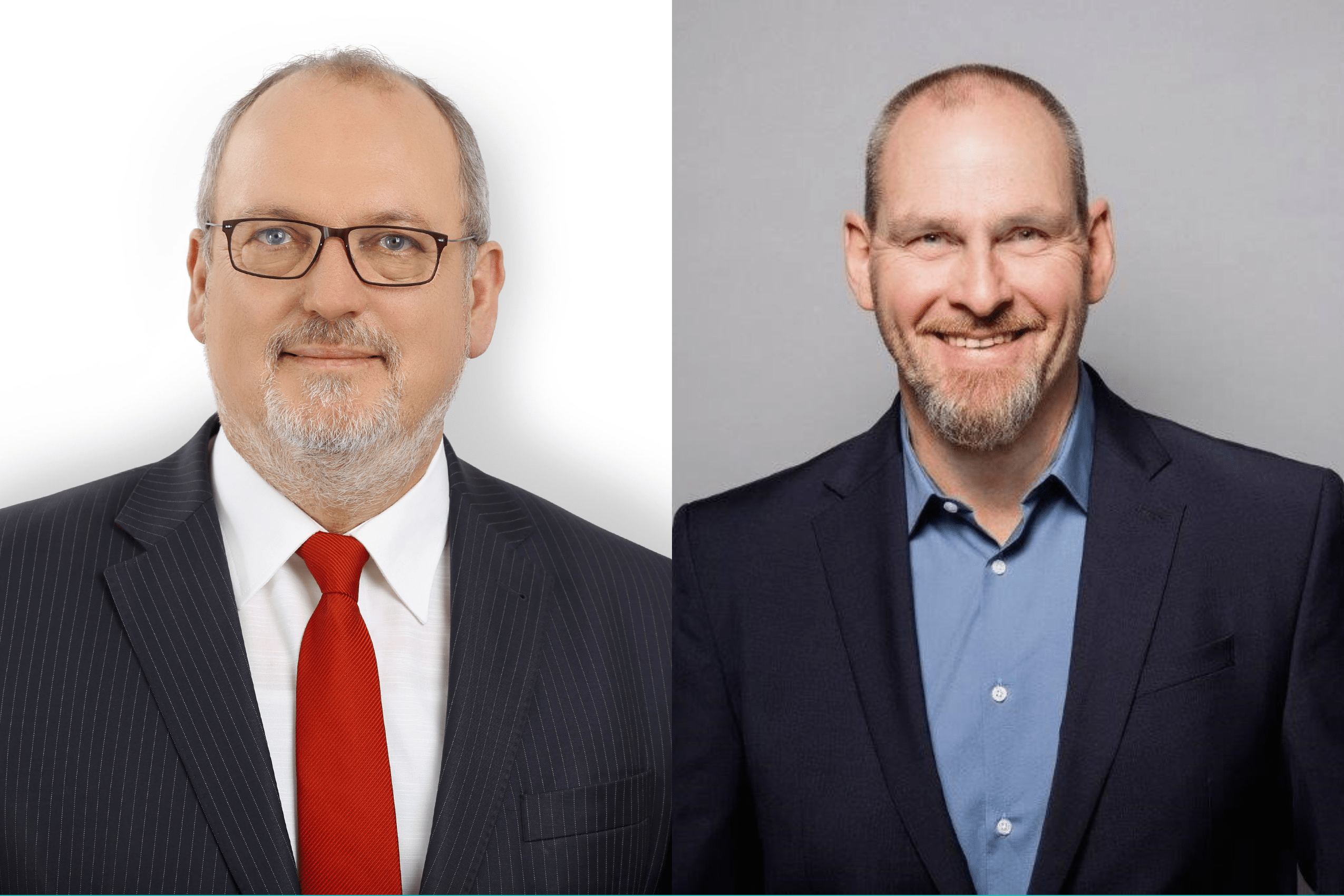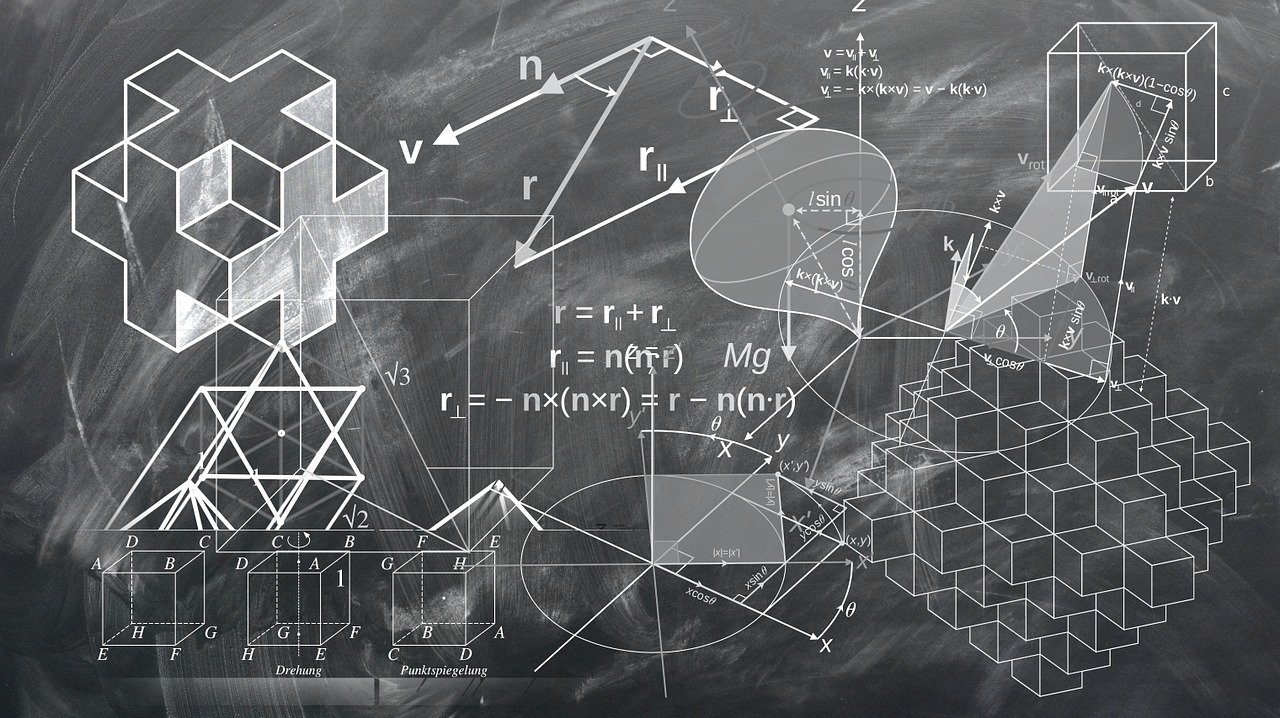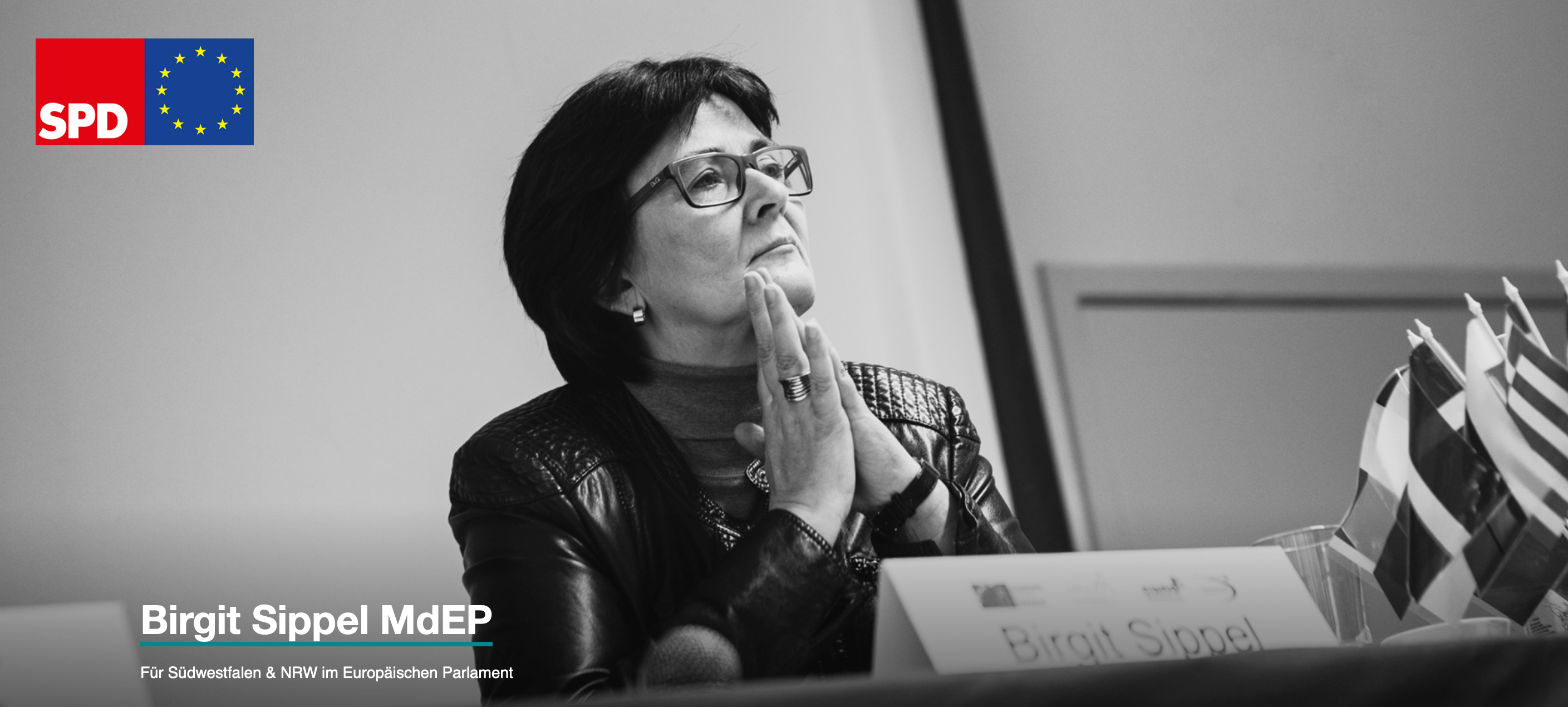Foto: Peter Hönnemann
Kanzler Olaf Scholz will mit der neuen Fortschrittsregierung Deutschland sozial, technologisch, gesellschaftlich und kulturell fit machen für die Zukunft.
„Ein modernes Deutschland, jederzeit auf der Höhe der Herausforderungen unseres Jahrhunderts – das ist das Ziel. Das ist die Aufgabe, die wir ab sofort anpacken“, sagte Kanzler Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung am Mittwoch im Bundestag.
Der Kanzler sprach den Bürgerinnen und Bürgern angesichts der aktuellen Corona-Lage Mut zu. „Ja, es wird wieder besser! Ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen. Und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen. Wir werden diese Krise überwinden.“
Um dies zu erreichen werden
- die Kapazitäten der Impfzentren deutlich erhöht,
- mobile Teams in Stadt und Land eingesetzt und
- alle die Möglichkeit erhalten, sich dreifach zu impfen.
„Jeder kann und sollte sich impfen lassen!“
Das ehrgeizige Zwischenziel: 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende um die vierte Welle hinter uns zu lassen. Davon sind 19 Millionen geschafft. „Meine dringende Bitte ist: Liebe Bürgerinnen und Bürger, machen Sie alle mit! Dann schaffen wir die 30 Millionen. Und dann sind wir am Ende des Monats diesen einen entscheidenden Zwischenschritt vorangekommen!“
Mehr Fortschritt wagen
In seiner Regierungserklärung machte Kanzler Scholz klar, was seine Regierung unter „Mehr Fortschritt wagen“ versteht: Zum einen geht es um sozialen Fortschritt, „weil Respekt, Gerechtigkeit und Lebenschancen für alle eben kein Gegensatz sind zu wirtschaftlicher Stärke – sondern deren Voraussetzung“. Zum anderen geht es um technischen Fortschritt – „weil wir nur mit technischem Fortschritt klimaneutral werden können; und weil Deutschland und Europa nur so mithalten können im globalen Wettbewerb.“ Notwendig sei zudem ein gesellschaftlicher und kultureller Fortschritt. Deshalb will der neue Kanzler Gesetz und Recht „an die Lebenswirklichkeit unseres vielfältigen Landes“ anpassen.
Sicherheit im Wandel
Die Klimakrise, die Transformation unserer Industrie und Ökonomie, die Globalisierung und Digitalisierung – in seiner Regierungserklärung zählte Olaf Scholz die großen Aufgaben auf, vor denen Deutschland zu Beginn der zwanziger Jahre steht. „Allen muss klar sein: Die vor uns liegenden zwanziger Jahre werden Jahre der Veränderung, der Erneuerung, des Umbaus sein“, sagte der Kanzler. „Alle in unserem Land wissen das. Wir brauchen diese Erneuerung.“
Olaf Scholz will mit seiner Fortschrittsregierung dafür sorgen, dass diese Erneuerung allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. „Wir werden neue Sicherheit durch Wandel schaffen und wir werden für Sicherheit im Wandel sorgen“, versprach er.
„Wir haben keine Zeit zu verlieren“
Dabei ist Fortschritt für den Kanzler kein Selbstzweck. Die neue Bundesregierung werde mit einem klaren Ziel einen Weg des Fortschritts, der Erneuerung und Transformation einschlagen: „Fortschritt für eine bessere Welt, für ein besseres Land, für eine bessere Gesellschaft, für mehr Freiheit, für jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger: Das ist der Fortschritt, den wir wollen.“
„Uns muss jetzt der Aufbruch gelingen. Gerade jetzt müssen wir handeln“, betonte Kanzler Scholz. Klar sei es ein Wagnis, aufzubrechen und den Weg der Veränderung einzuschlagen. „Aber: Dieses Wagnis müssen wir eingehen. Denn weitaus waghalsiger als Aufbruch und Fortschritt wären jetzt Stillstand und Weiter-so.“
Veränderung ist nur dann ein Fortschritt, wenn sich das Leben der Menschen verbessert. So begreift die neue Regierung die großen Aufgaben, die sich stellen. Es geht um einen Aufbruch hin zu einer klimaneutralen und digitalisierten Gesellschaft, die Sicherung unseres Wohlstandes, eine moderne, freie Gesellschaft. Bezahlbare Wohnungen, faire Arbeitsbedingungen und gute Löhne, die zum Leben reichen, eine Kindergrundsicherung, die Kinder aus der Armut holt, stabile Renten und Respekt für jedermann.
„Das wird gut ausgehen“
Viele Bürgerinnen und Bürger stellten sich die Frage, ob das alles gut für sie, ihre Familie, Kinder ausgehen werde, sagte Kanzler Scholz. Ob es auch in Zukunft noch gut bezahlte Arbeit, sichere Renten und ein gutes Gesundheitssystem geben werde. „Meine Antwort – die Antwort dieser Bundesregierung – ist sehr klar: Ja, das kann gut ausgehen. Und ja, das wird auch gut ausgehen“, betonte Olaf Scholz. „Wir nehmen die Herausforderungen unserer Zeit an. Und wir sind zuversichtlich: Wir werden sie bewältigen.“ Nicht, weil man die Probleme unterschätze. „Sondern weil wir einen präzisen Plan dafür haben, wie wir sie lösen können und wie es gut werden kann.“
Die Kernpunkte
Die Grundlage für einen Aufbruch für Deutschland in ganz entscheidenden Bereichen legt der Koalitionsvertrag:
- Die neue Bundesregierung stärkt den Respekt in unserer Gesellschaft, in dem sie unter anderem den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und ein Bürgergeld einführen wird.
- SPD, Grüne und FDP wollen für bezahlbares Wohnen sorgen, in dem 400.000 neue Wohnungen gebaut und die Mietpreisbremse verlängert werden.
- Bis spätestens Ende 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, indem die Erneuerbaren Energien massiv ausgebaut und die nachhaltige Mobilitätswende vorangetrieben wird.
- Die neue Regierung wird die Rente sichern und stabilisieren und schließt Rentenkürzungen sowie eine Anhebung des Renteneintrittalters aus.
- Damit kein Kind in Armut aufwachsen muss, wird eine Kindergrundsicherung eingeführt.
- Die neue Fortschrittsregierung will die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern und für eine bessere Bezahlung sorgen.
- Die Verwaltung soll modernisiert werden: einfacher und digitaler.
- Mit dem Digitalpakt 2.0 sollen den Schulen den Sprung in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts endlich schaffen.
„Fangen wir jetzt an“
Deutschland sei ein starkes Land, sagte Kanzler Scholz. „ Wir alle gemeinsam haben nicht den geringsten Grund, uns vor der Zukunft zu fürchten. Ganz im Gegenteil: Wenn wir zusammenhalten – in einer solidarischen Gesellschaft des Respekts; wenn wir uns ehrgeizige Ziele setzen und dem Fortschritt die richtige Richtung geben; wenn wir den Aufbruch jetzt entschlossen beginnen – dann werden wir nicht nur die Corona-Pandemie hinter uns lassen; dann werden wir in Deutschland auch gemeinsam erfolgreich sein. Und dann werden die Bürgerinnen und Bürger am Ende dieses Jahrzehnts sagen: ‚Ja, es geht gut aus. Es geht gut aus für mich, es geht gut aus für meine Familie und für unser Land.‘ – Das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft. Und mit dieser Arbeit fangen wir jetzt an.“