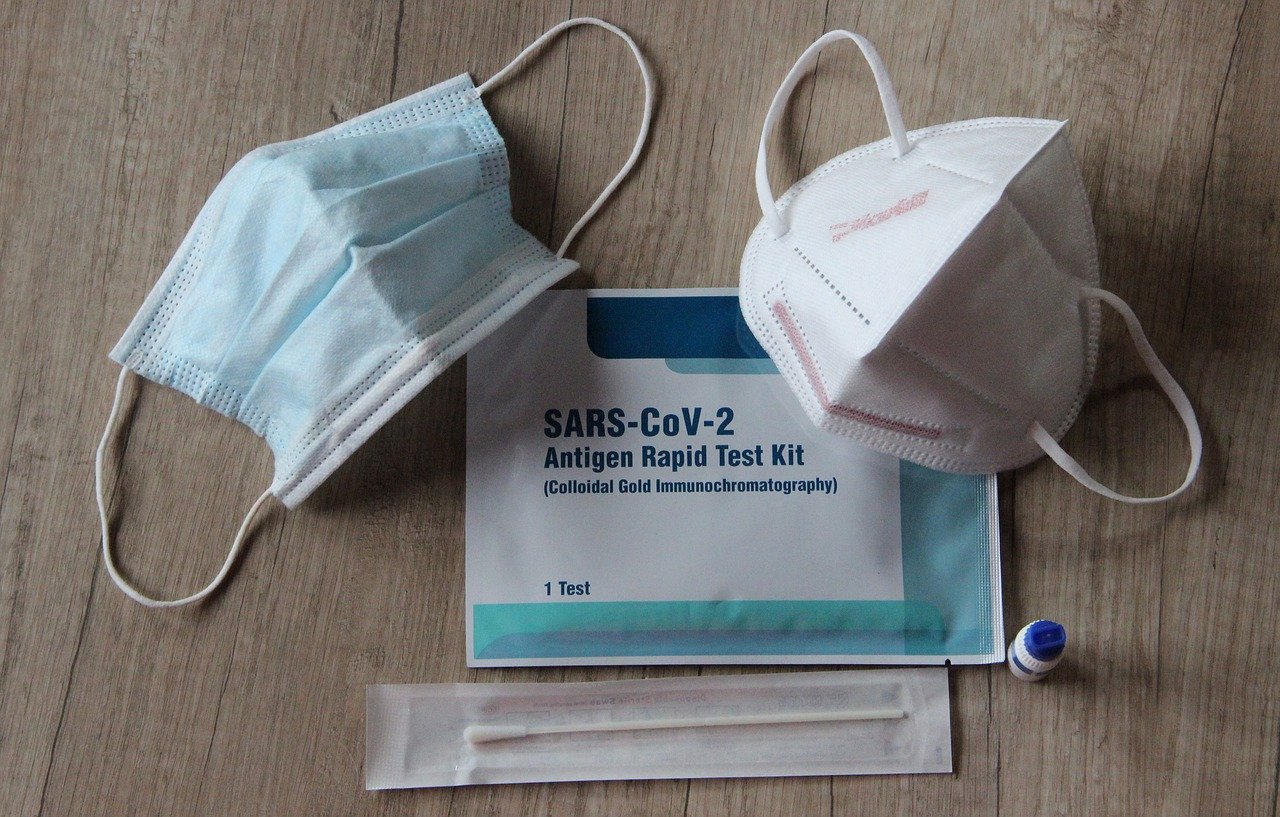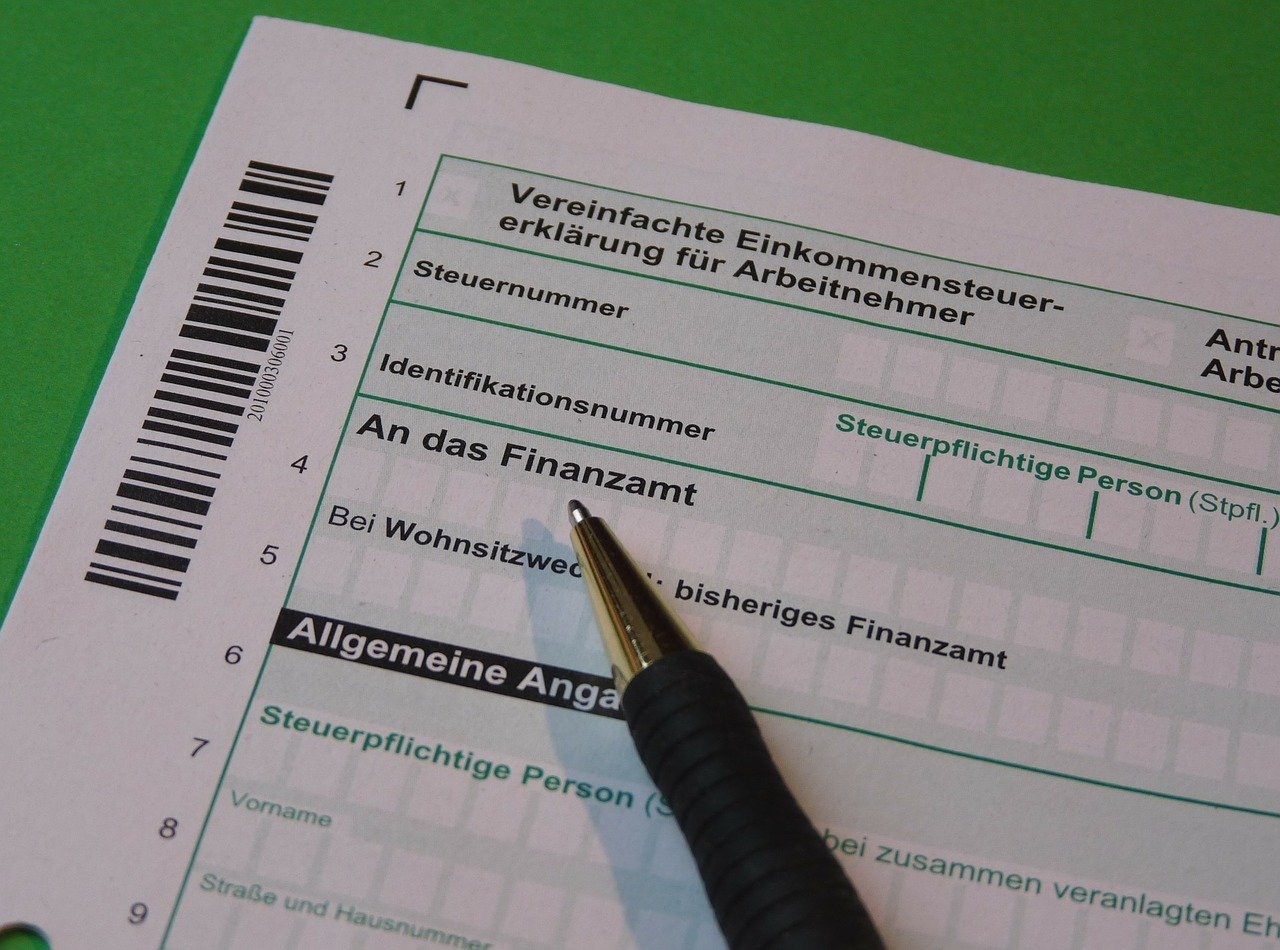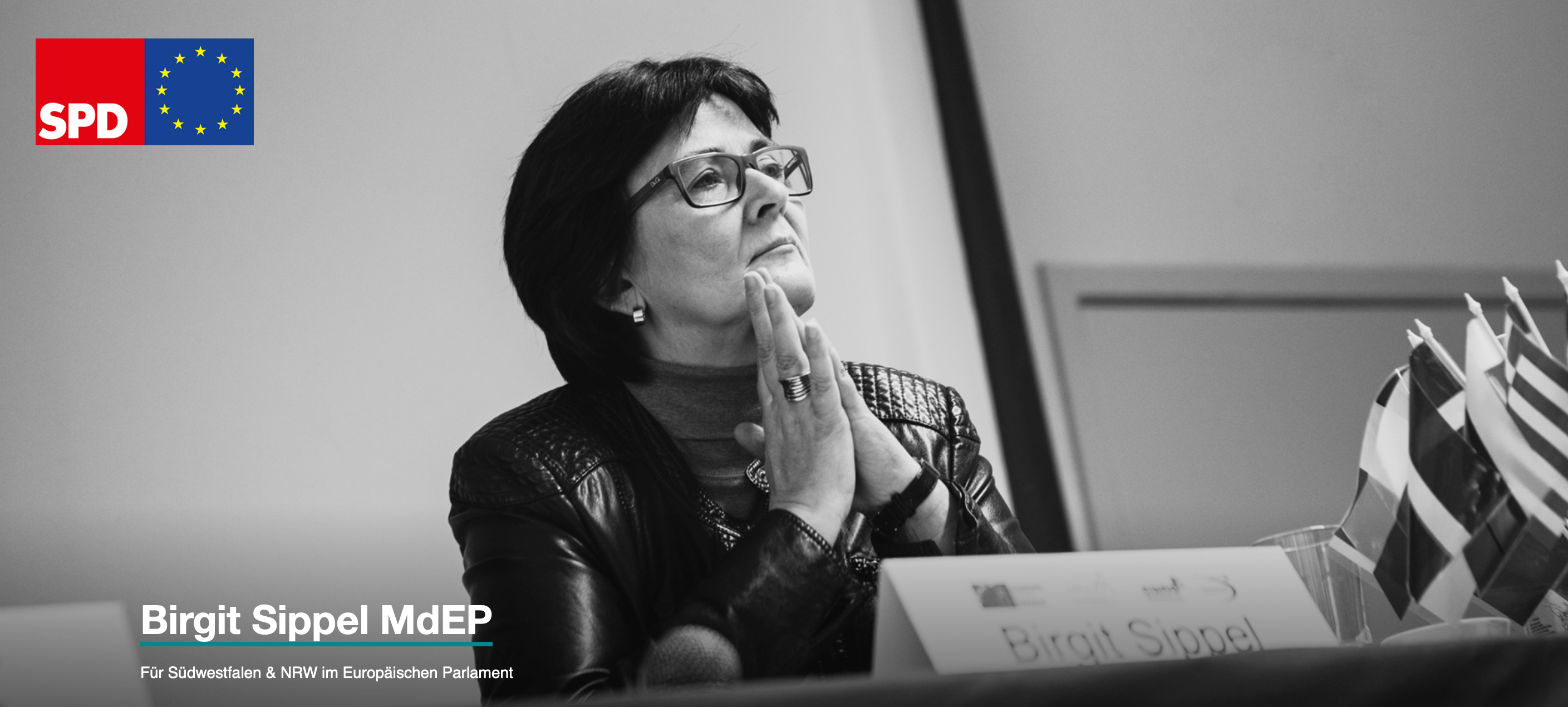Der Bedarf für eine Anpassung des Rechtsrahmens auf dem Markt für Rechtsdienstleistungen ist längst überfällig. Nach zähen Verhandlungen mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion konnten wir eine Einigung erzielen, somit steht dieses Gesetzesvorhaben kurz vor dem Abschluss. Es ist absolut notwendig, dass der Gesetzgeber auf die Rechtsunsicherheit, die auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt besteht, reagiert und entsprechende Widersprüche zwischen dem Inkassorecht dem Anwaltsrecht beseitigt.
Karl-Heinz Brunner, zuständiger Berichterstatter:
„Die Angebote von Inkassorechtsdienstleistern werden in zunehmendem Maße von Verbraucherinnen und Verbrauchern nachgefragt. Das Ziel des Legal Tech-Gesetzes ist, die Chancengleichheit zwischen Legal Tech-Anbietern und der Rechtsanwaltschaft zu erhöhen. Besonders im Fokus stehen dabei die die Prozessfinanzierung und das Erfolgshonorar, die – zurecht – sensible Themen sind, für die wir aber nun einen tragfähigen Kompromiss gefunden haben.
Erfolgshonorare dürfen nun unter anderem bei Forderungen bis 2.000 Euro, aber nicht bei höchstpersönlichen Forderungen vereinbart werden. Unser Modell für die Prozessfinanzierung hat zwei Vorteile: Wir ermöglichen es Anwältinnen und Anwälten im außergerichtlichen Verfahren, wo die meisten Fälle abgewickelt werden, nun ebenfalls den Verbraucherinnen und Verbrauchern interessante Beratungsmodelle anzubieten. Zum anderen bleiben die anwaltlichen ‚core values‘ gewahrt: Da im Gerichtsverfahren das finanzielle Risiko steigt, halten wir eine finanzielle Interessentrennung durch das Verbot der Prozessfinanzierung zwischen der Rechtsanwaltschaft und der Mandantschaft hier für den richtigen Weg.
Durch das Gesetz zur Reform des Rechtsdienstleistungsmarkt stärken wir zum einen Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Unternehmen, da diese von interessanten Beratungsangeboten der Rechtsanwaltschaft zur Durchsetzung von Forderungen profitieren werden. Zum anderen schaffen wir Rechtssicherheit im Spannungsfeld zwischen Inkassorechtsdienstleistern und der Rechtsanwaltschaft, die nun deutlich flexiblere Vergütungsmodelle anbieten kann.“