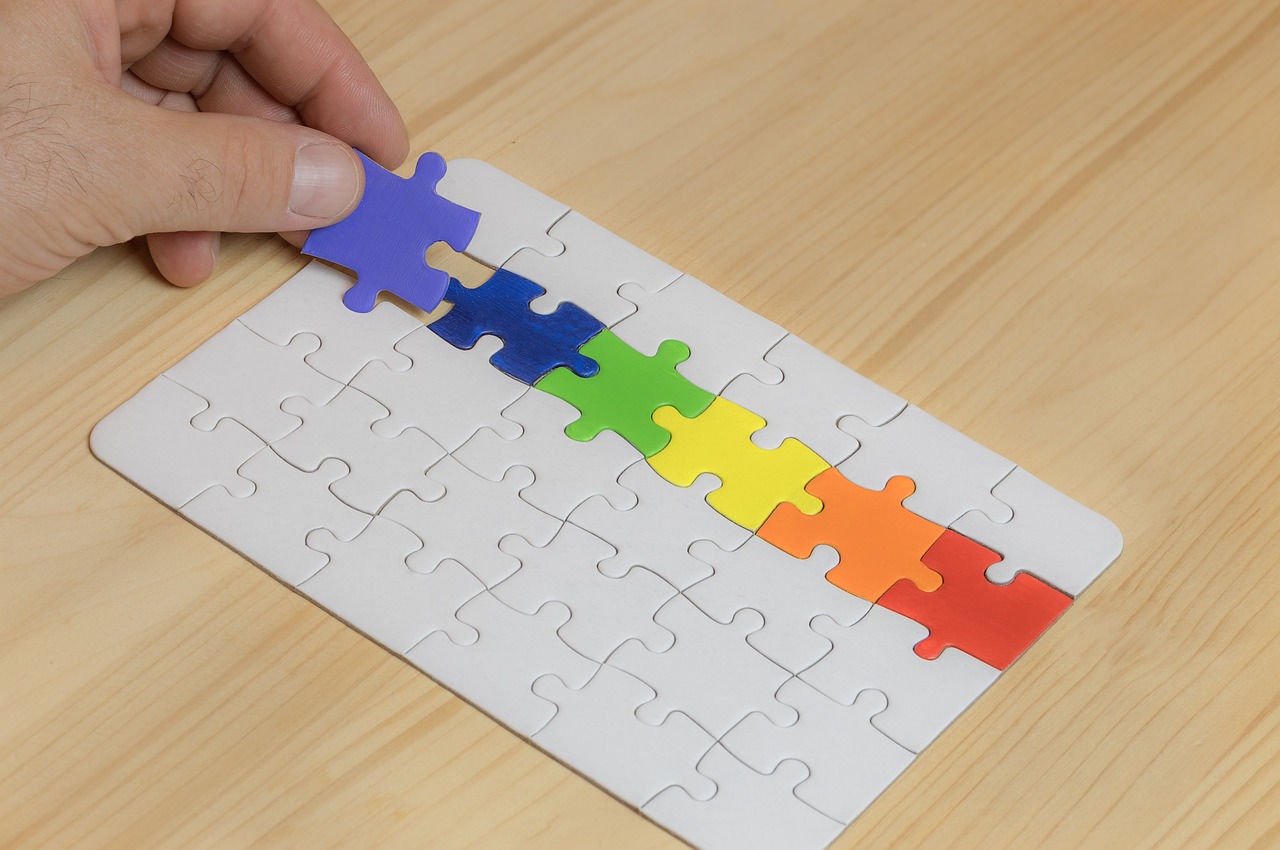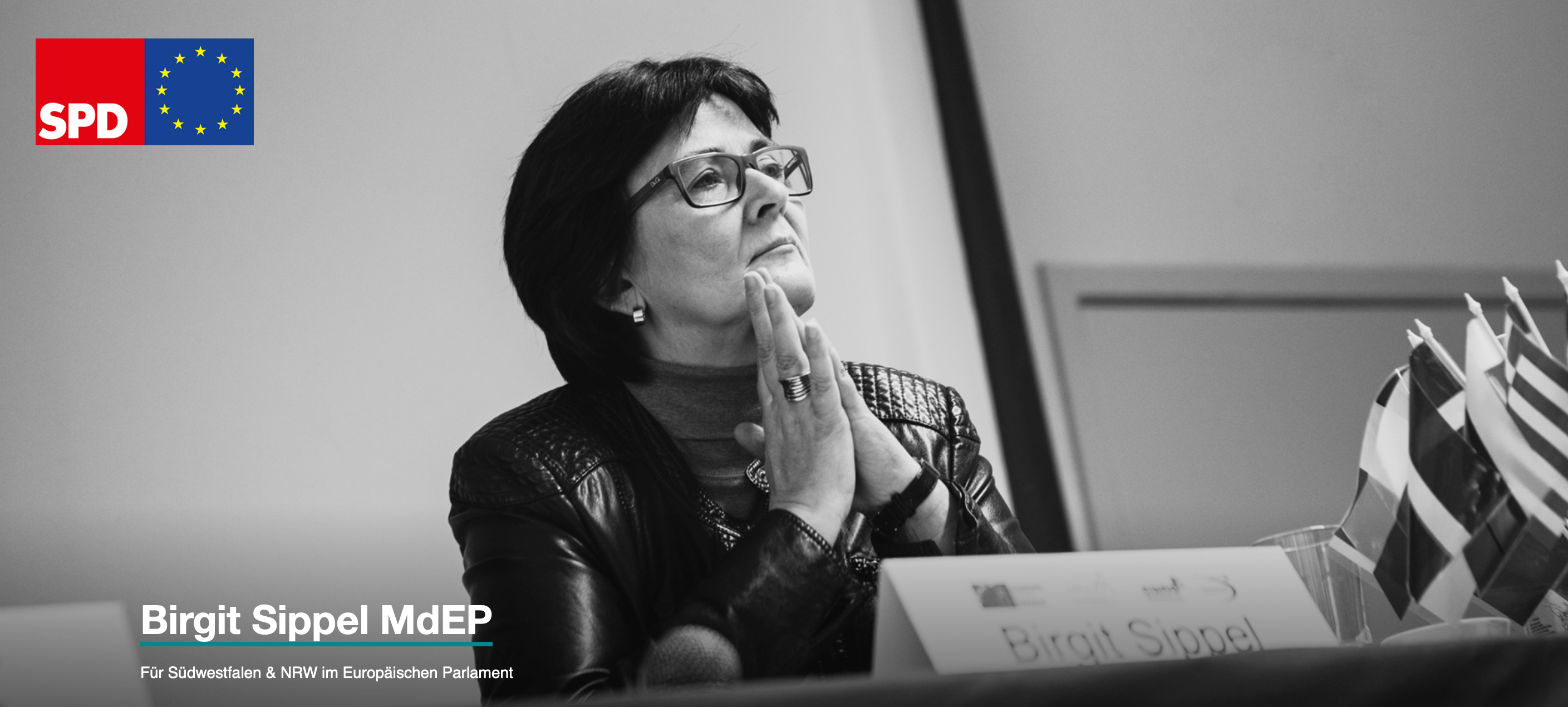Der Landtag hat heute den SPD-Antrag „Eine bessere Pflege für NRW: mehr Fürsorge, weniger Aufwand und Bürokratie – Pflegelotsen, Investitionen und Entlastung für Angehörige!“ beraten.
Hierzu erklären Lisa Kapteinat, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag NRW, und Thorsten Klute, Sprecher für Gesundheit und Pflege:
Lisa-Kristin Kapteinat:
„Pflege darf nicht arm machen – und sie darf Menschen nicht an ihre körperlichen und seelischen Grenzen treiben. In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Pflegebedürftigen rasant, gleichzeitig sinkt die Zahl der Pflegekräfte und immer mehr Einrichtungen geraten in wirtschaftliche Not. Minister Laumann weiß das alles, er hat es heute selbst bestätigt – doch er konnte nicht erklären, wie er die Pflege in NRW konkret verbessern will. Statt Entlastung erleben Pflegekräfte und pflegende Angehörige immer mehr Druck, immer mehr Bürokratie und immer mehr Überforderung. Wir als SPD sagen klar: Pflege braucht mehr Fürsorge und weniger Verwaltungsaufwand, bessere Arbeitsbedingungen statt leerer Versprechen und eine Politik, die pflegende Angehörige endlich als das anerkennt, was sie sind: eine unverzichtbare Säule unseres Pflegesystems. Unser Antrag liegt auf dem Tisch. Wer es ernst meint mit der Pflege in NRW, muss jetzt handeln.“
Thorsten Klute:
„Über 3.500 Euro Eigenanteil im Monat im ersten Jahr im Pflegeheim – nirgendwo in Deutschland ist Pflege teurer als in Nordrhein-Westfalen. Diese Zahlen machen Pflegebedürftige arm und treiben die Kommunen immer tiefer in die finanziellen Schwierigkeiten. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat in der Debatte heute selbst eingeräumt, dass diese Entwicklung nicht tragbar ist und den Zielen unseres Antrags eigentlich zugestimmt. Doch statt endlich eigene Vorschläge vorzulegen, bleibt er seit Jahren untätig. Während immer mehr Menschen Hilfe zur Pflege benötigen, Pflegekräfte fehlen und Pflegeplätze wegfallen, herrscht bei Schwarz Grün Stillstand. Unser Antrag zeigt konkrete Wege aus der Krise: Pflegelotsen, die Menschen durch den Pflegedschungel begleiten, mehr Unterstützung für ambulante Dienste und Tagespflegen, echte Entlastung für Angehörige und endlich ein Abbau der ausufernden Bürokratie. Zustimmung ohne Handeln hilft niemandem – weder den Pflegebedürftigen, noch ihren Familien.“