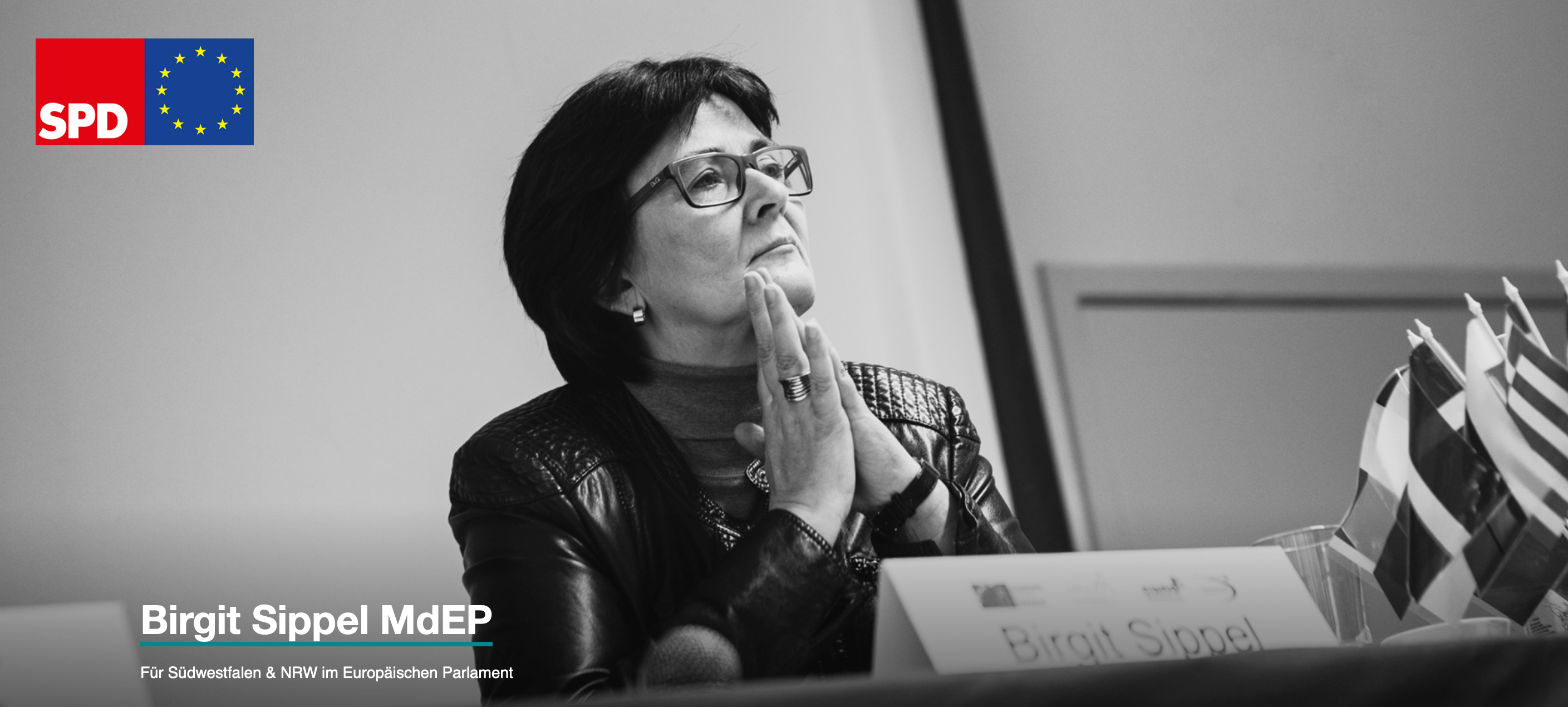Foto: pixabay.com
In seiner heutigen Sitzung hat sich der Innenausschuss des Landtags NRW in einer Aktuellen Viertelstunde mit der tödlichen Attacke auf einen 25-Jährigen beim Christopher Street Day in Münster befasst.
Hierzu erklären Christina Kampmann, innenpolitische Sprecherin, und Frank Müller, Queer-Beauftragter der SPD-Fraktion im Landtag NRW:
Christina Kampmann:
„Die tödliche Attacke auf dem CSD in Münster macht uns weiter tief betroffen. Bei einem Fest für Toleranz und Liebe wurde der junge Mann brutal angegriffen, weil er Zivilcourage zeigte. Der Fall unterstreicht: Queeren-Feindlichkeit, Homo-, Bi- und Transphobie sind weiter große Probleme in unserer Gesellschaft.
Der Bericht von Minister Reul zur Attacke in Münster ist dabei ernüchternd. Der Minister konnte keine Angaben zum Polizeiaufgebot beim CSD in Münster machen. Zudem steht fest: Tatsächlich muss der Minister mehr zum Schutz und für Toleranz gegenüber queeren Lebens tun. Wir nehmen seine Ankündigung beim Wort. Denn ob und was der Minister bislang getan hat, war zu keinem Zeitpunkt ersichtlich.
Minister Reul möchte zudem prüfen, ob das Dunkelfeld bei Straftaten gegen queeres Leben ausgeleuchtet werden kann. Was gibt es da noch zu prüfen? Wir fordern Innenminister Reul auf, dass er endlich eine Dunkelfeldstudie zu Straftaten gegen queere Menschen in Auftrag gibt. Nur durch die konsequente Untersuchung der Dunkelfelder kann den Straftaten wirkungsvoll begegnet werden. Die gegenwärtige Kriminalstatistik reicht nicht aus. NRW braucht daher auch eine Dunkelfeldstudie, um zielgenau Maßnahmen ergreifen zu können. Nur so wird es auch gelingen, queere Hasskriminalität präziser zu erfassen und zu verhindern. Genauso brauchen wir Kontaktbeamtinnen -und beamte für die queere Community bei der Polizei. Das schafft Vertrauen und Sicherheit.“
Frank Müller:
„Null-Toleranz bei Homo-, Bi- und Transphobie und jegliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit darf keine Phrase sein. Alle demokratischen Kräfte im Land müssen dafür einstehen. Gemeinsam müssen wir die Sichtbarkeit queeren Lebens in Nordrhein-Westfalen erhöhen. Mit Sichtbarkeit schaffen wir Toleranz. Vollständige Akzeptanz und Gleichstellung bleibt unser Ziel.
Das ist eine Querschnittsaufgabe für viele Politikbereiche in Nordrhein-Westfalen. Daher werden wir die Attacke beim CSD in Münster auch im Gleichstellungsausschuss aufgreifen. Denn wir brauchen mehr als sicherheitspolitische Verbesserungen. Wir müssen beispielsweise queere Jugendangebote in Stadt und Land fördern und ausbauen. Ebenso wollen wir Schutzräume für die Community erhalten und neue schaffen. Denn es darf nicht sein, dass Menschen bei uns Angst haben, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu zeigen.“